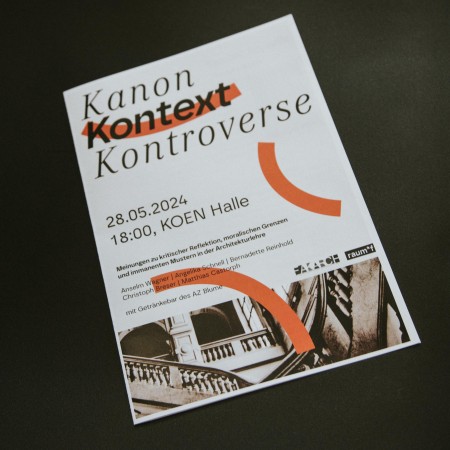Die gute Nachricht zu Beginn: die Studierenden der TU Graz trauen sich wieder in die stürmischen Gefilde des kritischen Diskurses. Initiiert von raum*f und der fakarch fand am Dienstagabend eine Podiumsdiskussion zum Thema „Kanon Kontext Kontroversen” statt: Christoph Breser, Matthias Castorph, Bernadette Reinhold, Angelika Schnell und Anselm Wagner waren als Podiumsgäst*innen eingeladen und sollten als Expert*innen der Architekturgeschichte und -theorie über „Meinungen zu kritischer Reflexion, moralischen Grenzen und immanenten Mustern in der Architekturlehre” diskutieren. Kurzum: ein ambitioniertes Unterfangen.
Der Kontext des Abends
Der Anspruch der Veranstaltenden war es, den gelehrten und gelernten Kanon zur Disposition zu stellen. Für raum*f und die fakarch, vertreten durch das Moderationspaar Jakob und Kathi, war dabei besonders der Aspekt von Interesse, dass Architektur im wahrsten Wortsinn Bestand hat, auch wenn sich Begrifflichkeiten und Werte der Gesellschaft ändern. Durch mutmaßlich unkritische Rezeption entsteht so ein „immanenter Wissenskanon”, den Studierende mittlerweile stark hinterfragen.
Der Abend sollte dieser Asynchronität Rechnung tragen und verschiedene Positionen in der Debatte aufzeigen. Weiters wollte man ergründen, ob man das Feld der Theorie dazu verlassen muss und eventuell im Entwurf beziehungsweise der Entwurfslehre neue Zugänge dafür finden vermag. Gerade weil zwei der Diskutant*innen, Anselm Wagner und Matthias Castorph, Instituten an der TU Graz vorstehen, war das studentische Interesse und damit auch deren Anwesenheit wohl besonders groß.
Belastungen muss man aushalten
Als Einleitung diente den Moderator*innen Jakob (raum*f) und Kathi (fakarch) die Frage, wie man als Forschende*r mit belasteten Objekten und Personen umgehen kann. Breser greift die Multiperspektivität auf, die er auch im Rahmen seiner Doktorarbeit über faschistische Planungsethik anwendet: Das ist erstens die individuelle Perspektive der Architekt*in, zweitens die institutionelle Perspektive, also die Eingebundenheit der Akteur*in, und drittens die rechtlich-normative Ebene. Castorph ergänzt um eine historisch-holistische Sicht auf die Dinge: Das, was sich gerade im Entstehen befindet, ist nicht wirklich zu trennen von dem, was bereits da ist. Letztlich kann Architektur immer gebraucht oder missbraucht werden. Angelika Schnell ergänzt, dass es eben gar keine unbelastete Stadtplanung gibt. Die ideologischen, politischen, sozialen und andere Kontexte sind immanent. Widersprüchlichkeiten müssen nicht nur erkannt, sondern letztlich auch ausgehalten werden von jenen, die sich mit ihnen befassen, egal ob wissenschaftlich oder als praktizierende Architekt*innen.
Die „moralische Brille” bietet nicht zwingend eine klare Sicht
Wagner zieht einen inhaltlichen Kreis zum Veranstaltungsfolder, der in der Halle auf den Sitzplätzen ausgelegt wurde. Dort wird bereits darauf hingewiesen, dass sich Inhalte von Werten und Begriffen über die Zeit auch ändern. Das bedeutet, dass vieles Problematische eben erst in der Gegenwart als problematisch gesehen wird. Nicht alles darf durch die „moralische Brille” betrachtet werden und letztlich ist es wichtig den eigenen Kontext nicht zu vergessen, aus dem heraus man Meinungen und Wertungen vornimmt. In der Architektur gibt es viele moralische Widersprüche, mit denen wir umgehen müssen. Das betrifft oft die Kombination „schlechter Mensch, guter Architekt”. Ähnlich sensibel müssen wir auch mit umstrittenen oder geschichtlich belasteten Begriffen umgehen, wie beispielsweise der Baukultur, die genauso wie kanonische Bauwerke in der Lehre verwendet werden.
Was bedeutet es, im Kanon zu sein?
Der Kanon ist fundamental für das Lernen, aber ebenso muss man sich auch an ihm reiben können. Er ist eine Verkürzung eines etablierten Wertesystems (man denke an Buchtitel wie „100 Famous Architects”) und wir müssen uns, geht es nach Bernadette Reinhold, die Frage stellen, wie man ihn aufbrechen kann. Castorph ergänzt, dass auch der Begriff Kanon selbst problematisch ist. Angelika Schnell sieht in ihm einen „Nimbus des Unantastbaren oder Heiligen”, was auch seinem Ursprung aus der Theologie entspricht. In der Prozesshaftigkeit, die der Architektur innewohnt, sei eine derartige Pauschalisierung auch gar nicht möglich; es kann lediglich den Versuch geben, gewisse Diskurse, Theorien und dergleichen prägnant zu machen, ohne letztlich dabei einen unverrückbaren Kanon zu entwerfen. Die am Abend eingangs erwähnte Moderne, die unseren Lehr-Kanon prägt, sei letztlich gar keine stringente Stilrichtung gewesen. Auch sie ist ein Opfer der pauschalisierten Feindbildung, die eine differenzierte Betrachtung nachhaltig erschwert.
„Operabel bleiben”
Aus der Lehrerfahrung sprechend erinnert Wagner daran, dass ein Kanon gezwungenermaßen in den Köpfen der Studierenden Form annimmt, und dass dies nicht zufällig passiert, sondern die kanonischen Werke schließlich aus Schnittmengen unterschiedlicher Fachbereiche entstehen. Einig sind sich ebenfalls Reinhold und Schnell, wenn es darum geht, den Kanon als problematisches, aber notwendiges Element in der Architektur zu sehen. Kanonische Werke „müssen wir einfach kennen”, gesteht Reinhold, findet den Ansatz ihres Podiumskollegen Castorph allerdings relativistisch, wenn dieser attestiert, dass es eine Herausforderung ist, bei all der Kenntnis um Referenzobjekte selbst noch immer „operabel” zu bleiben. Daher müsse man folglich Abstriche machen. Es helfe aber, dass sich Theoretiker*innen und Praktizierende in gewisser Weise ergänzen; wenn die einen wissen, und die anderen anwenden, meint Castorph.
Szenenapplaus und Fußballweisheiten
Als sich die Diskussion zunehmend im Aspekt der Bedeutung bzw. dem Missbrauch von Balkonen verheddert, greifen letztlich die Moderator*innen ein und stellen die herausfordernde Frage, welche Hands-on-Tools es im Entwerfen gibt, um mit einem Kanon umgehen zu können. Der einzige und respektable Szenenapplaus des Abends gebührt daraufhin Wagner für die Aussage, am Studienplan und in der Lehre der TU Graz müsse sich unbedingt etwas ändern. Die weiteren praktischen Tipps des Podiums lauten Architekturgeschichtliches Wissen schulen, und durch Entwurf und Theorie das jeweils andere kritisch reflektieren.
Die Rolle des historischen Wissens wird besonders hervorgehoben: Geschichte als Vergangenheit zu begreifen, ist falsch. „In dem Moment, wo man auf Geschichte schaut, muss man sich dazu positionieren“, sagt Reinhold und ergänzt, dass die Art, wie man sich mittels Fragestellung an etwas Geschichtliches annähert, sehr viel über unsere Gesellschaft aussagt. Für die Wichtigkeit des praktizierten Diskurses sprechen sich Breser und Castorph aus. Letzterer sieht die Architektur nichtsdestotrotz als eine konstruktive, entwerferische Tätigkeit und erweitert die Diskussion um die unumstößliche Philosophie des Sports: „Die Wahrheit des Fußballs ist auf dem Platz.”
It’s the Struktur, stupid!
Auf die abschließende Frage, wie stark ein Kanon von den vorherrschenden Strukturen, beispielsweise Institutsleiter*innen, abhängt, und ob eine Dekanonisierung möglicherweise unter anderen Strukturen besser funktionieren würde, antwortet Schnell, dass genau dieser Sachverhalt den Kanon so politisch mache, weil er ja immer auch etwas Strukturelles sei.
Das Schlußwort hat Waltraud Indrist, Doktorandin am Institut für Architekturtheorie, Kunst- und Kulturwissenschaften, aus dem Publikum sprechend, als es um die Trennung von Autor*innen und ihren Werken geht. Sie erinnert die Anwesenden daran, dass man durchaus methodisch eine Trennung vornehmen könne, dies jedoch nicht immer oder allumfänglich möglich sei. Wer das Werk Heideggers beispielsweise nicht im Kontext betrachtet, könne es nicht gänzlich verstehen. Der Kontext trägt also zu einem besseren Verstehen bei, sei es nun im Kanon, oder außerhalb dessen.
Ähnlich verhält es sich mit diesem Abend: Das rege Interesse des Publikums zeigt eindringlich, dass reine Diskussionsveranstaltungen eine fehlende Lücke des universitären Diskursraums füllen. Bei zunehmender Erfahrung und stoischer Entspanntheit, kann diesem Format ohne Probleme eine fruchtbare Zukunft attestiert werden. Ist das gar ebenfalls ein strukturelles Symptom?